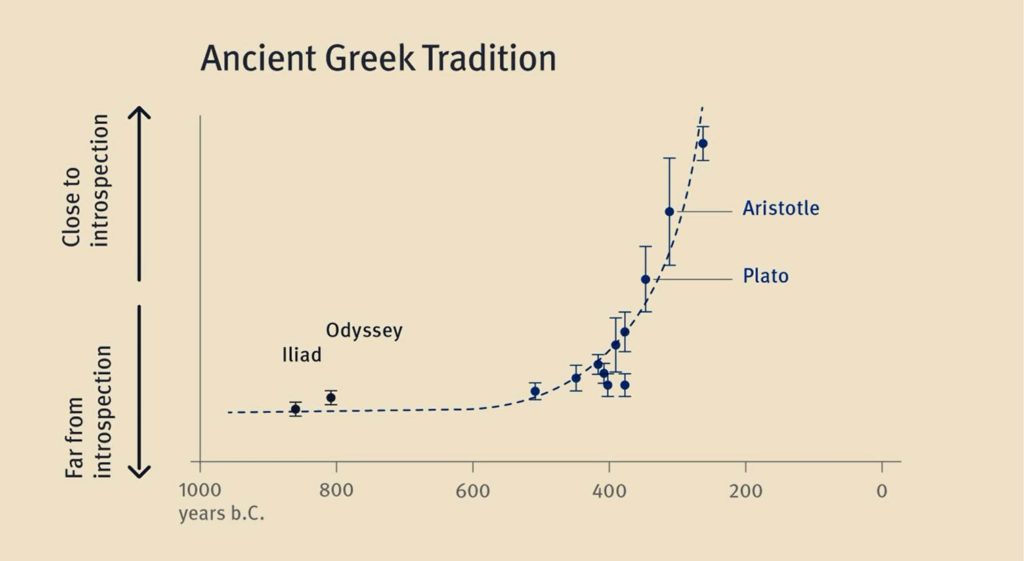Was bringen Kommentare in sozialen Medien? Um diese Frage zu beantworten, muss ich ein bisschen ausholen:
Es ist nun schon eine ganze Weile her, dass das Radio erfunden wurde. Doch als es noch ein brandneues Medium war, damals in der Weimarer Republik, fanden sich bereits Kritiker, die es besser machen wollten. Berthold Brecht war einer dieser Kritiker. Ihm war das Radio zu einseitig: Immer spricht nur einer und alle anderen hören zu. Brecht wünschte sich in seiner „Radiotheorie“, dass jeder Empfänger auch ein Sender ist. Würde das gelingen, hätte man den „denkbar großartigsten Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem“.
Nun scheint diese Vision im Web 2.0 erfüllt zu sein. Jeder kann heute Feedback geben, Kommentare in sozialen Medien schreiben und nach Herzenslust diskutieren. Aber ist das deswegen tatsächlich Brechts „großartiger Kommunikationsapparat“? Ich denke, das würde er gerade als Antikapitalist anders sehen. Und auch ich als freiheitlicher Demokrat sehe das anders, denn Wirkung und Nutzen sind in den sozialen Medien sehr ungleich verteilt.
Wirkung.
Immer noch gibt es zwei unterschiedliche Machtebenen in den neuen Medien: Diejenigen, die – idealerweise mit einer starken Marke im Rücken – Artikel, Videos und Bilder posten und diejenigen, die lediglich kommentieren, bewerten, diskutieren. Einen Artikel und ein Posting zu erstellen, geht relativ schnell. Aber wie viel Zeit die Menschheit anschließend mit Kommentaren und Diskussionen verbringt, das gehört schon in die Kategorie „volkswirtschaftlicher Schaden“. Denn was hat die größere Wirkung: Ein SPIEGEL-Artikel oder die Diskussion darüber? Ganz klar: Der SPIEGEL-Artikel wirkt, die Diskussion darunter ist für die Mülltonne – nicht immer inhaltlich, aber auf jeden Fall von der Wirkung her gesehen. Das liest sich doch kein Mensch durch und selbst wenn einmal Diskussionen entstehen, bestehen diese nicht aus Argumenten sondern aus Meinungsblasen. Der eine Stamm im „Global Village“ zeigt dem anderen seine Kriegsbemalung – verstehen will man einander nicht. Und man soll es ja auch gar nicht, sonst würde den sozialen Medien schnell die Kontroversen ausgehen und damit ihr „Treibstoff“. Es ist ein bisschen wie im Monty-Python-Sketch „The Argument Clinic“, in dem Diskussionen so ablaufen, dass einfach immer nur das Gegenteil von dem behauptet wird, was der andere sagt. Eine solche Diskussion ist nicht befriedigend, denn sie führt zu nichts. Im besten Fall kann man darüber lachen, aber eben nur, weil alles so nutzlos war.

So laufen Kommentare in den sozialen Medien ab: Man steht sich gegenüber, erst schießt der eine, dann der andere. Am Ende sind beide tot (bzw. auch nicht klüger).
Nutzen.
Wenn die Kommentare in sozialen Medien also inhaltlich irrelevant und in ihrer Masse derart sinnlos sind, warum kommentiert man dann überhaupt? Entweder, weil man diese banale Tatsache verkennt oder weil man sich selbst und seine Meinung halt wenigstens irgendwo lesen möchte. Dass diese Meinung die meisten anderen überhaupt nicht interessiert, ist einem egal Und so schreiben alle fleißig ihre Kommentare und glauben, damit einen ungeheuren Beitrag zur öffentlichen Debatte geleistet zu haben. Den einzigen wirklichen Nutzen haben die Kommentare aber für die Medienplattformen. Die Anzahl der Reaktionen auf einen Beitrag, nicht die inhaltliche Qualität, ist die Währung, die den Wert des Beitrags bestimmt. Der fleißige Kommentierer hat also immerhin bei der Marktforschung geholfen. Brav!
Lösung?
Weder der Antikapitalist Bertolt Brecht, noch der Demokrat von heute können also damit zufrieden sein, dass unsere Diskurse nur noch für die Marktforschung taugen. Meine persönliche Lösung ist zweigeteilt:
- Mehr posten, weniger kommentieren.
- Diskussionen persönlich führen.
Mit dem zweiten Punkt meine ich, dass ich mein Gegenüber auffordere, mit mir in einen persönlichen Mail-Dialog abseits der sozialen Medien zu treten. Das bringt zwei Vorteile mit sich: Zum einen bekommen die Marktforscher kein Futter mehr und zum anderen wird die öffentliche Diskussion dadurch privat, zielführend und man spricht viel gesitteter miteinander, als wenn man sich wie vorher vor aller Welt ankeift.
Funktioniert super, einfach mal ausprobieren!